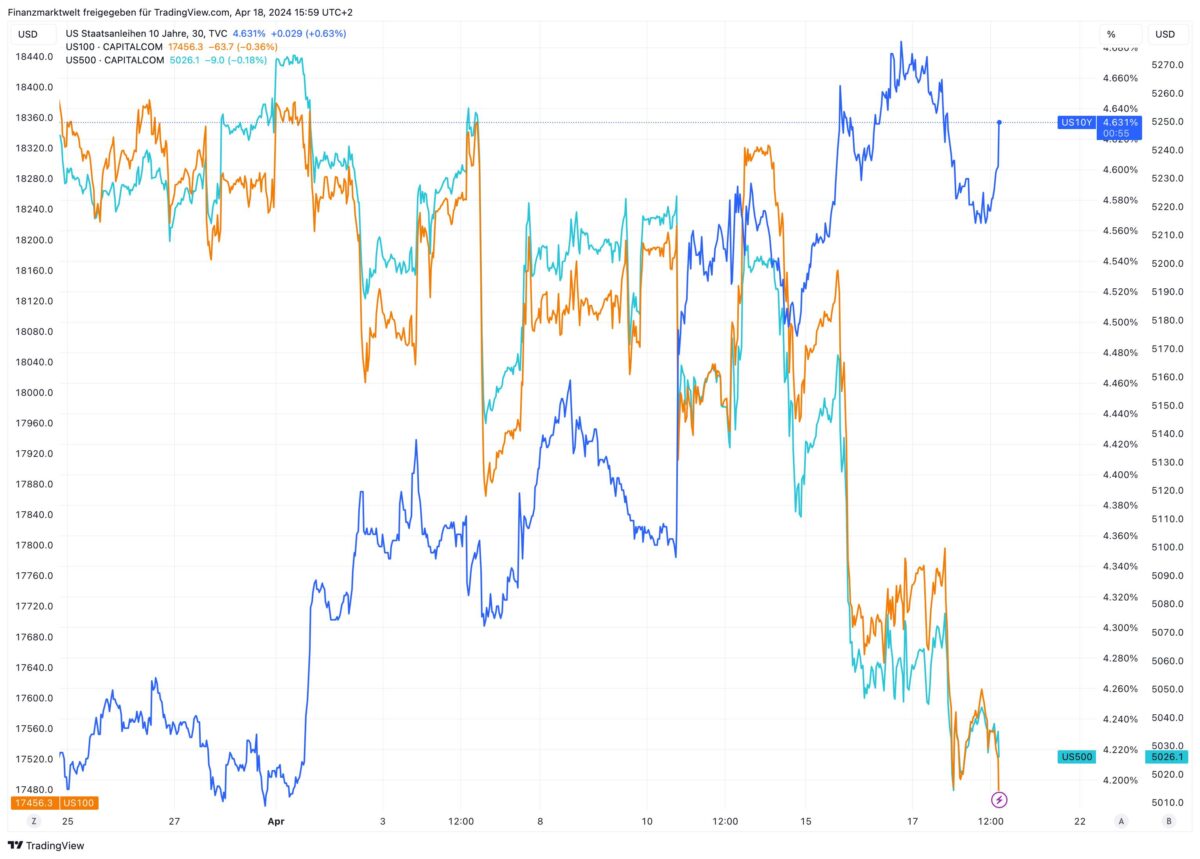Von Josef Braml
(Hinweis der FMW-Redaktion: Die Analyse von Josef Braml, einem führenden USA-Experten, skizziert Szenarien, die auch für die Entwicklung der Finanzmärkte von großer Relevanz sind!Der Beitrag von Josef Braml erschien zuerst bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und erfolgt hier mit freundlicher Genehmigung des Autors)
Vorentscheidung über die Zukunft Donald Trumps, Amerikas und der internationalen Beziehungen bei den Zwischenwahlen am 6. November
Am 6. November können die USA zwar nicht unmittelbar den Präsidenten bestätigen oder abwählen. Aber über die Kongresswahlen haben die Wähler eine mittelbare Möglichkeit, den Handlungsspielraum ihres Staatschefs mitzubestimmen. Sollte sich die Machtkonstellation in beiden Kongress-Kammern grundsätzlich ändern, droht Präsident Trump sogar ein Amtsenthebungsverfahren. Doch Trump könnte auch gestärkt aus den Wahlen hervorgehen. Deutschland und Europa können mit fünf Szenarien rechnen, auf die sie ihre künftige Außenpolitik ausrichten müssen, analysiert der USA-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik Josef Braml.
Die Zwischenwahlen in den USA sind vor allem eine Abstimmung über den amtierenden Präsidenten Donald Trump. Die neuen Machtverhältnisse in Abgeordnetenhaus und Senat stellen die Weichen für eine mögliche Wiederwahl Trumps. Selbst der erwartete Verlust der republikanischen Mehrheit des Abgeordnetenhauses könnte Trump helfen: Mit einer demokratischen Mehrheit wäre es für ihn einfacher, sein kostspieliges Infrastrukturprogramm zu finanzieren. Dies ist jedoch nur eines von fünf möglichen Szenarien, auf das sich deutsche Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft einstellen sollten.
Auf den Ausgang der Wahlen bezogen sind zunächst vier Szenarien denkbar:
▶︎ Szenario eins: Die Republikaner behalten die Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses, also im Abgeordnetenhaus und im Senat. Damit wäre Donald Trump gelungen, was in der US-amerikanischen Geschichte wenige Präsidenten vor ihm geschafft haben: nach zwei Jahren ihrer Amtszeit bei den Zwischenwahlen, wenn nur Abgeordnete und Senatoren zur Wahl stehen, nicht Sitze und Mehrheiten im Kongress zu verlieren. Trump würde gestärkt aus den Kongresswahlen hervorgehen – auch mit Blick auf seine weitere Regierungsführung und eine mögliche Wiederwahl in zwei Jahren.
▶︎ Szenario zwei: Die Republikaner verlieren nur das Abgeordnetenhaus, verteidigen aber ihre Senatsmehrheit. Trump hätte dann größere Schwierigkeiten, seine Wahlversprechen umzusetzen, etwa eine „große Grenzmauer zu Mexiko zu bauen“. Zumal werden diese Vorhaben auch mit US-Steuergeldern finanziert und müssen damit von beiden Kongress-Kammern bewilligt werden. Hingegen dürfte es für Trump mit einer demokratischen Mehrheit im Abgeordnetenhaus sogar etwas einfacher werden, seine kostspieligen Infrastrukturpläne durch den Kongress zu bringen, der über die Budgethoheit verfügt. Falls die Sonderermittlungen in der Russland-Causa auch ihn persönlich belasten sollten, könnte eine neue demokratische Mehrheit im Abgeordnetenhaus zwar ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump einläuten. Aber mangels einer Mehrheit in der dafür entscheiden Senatskammer würde das „Impeachment“-Verfahren, wie seinerzeit schon gegen Bill Clinton, abgewendet werden können.
▶︎ Szenario drei: Die Republikaner verlieren nur die Senatsmehrheit, verteidigen aber ihre Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Die Demokraten könnten den Gesetzgebungsprozess stärker kontrollieren und bei Bedarf auch blockieren. Trump hätte in diesem Fall auch größere Schwierigkeiten, Personal für Ministerien und Gerichte über die parlamentarischen Kontrollinstanzen, die relevanten Senatsausschüsse und das Plenum, zu schleusen.
▶︎ Szenario vier: Die Republikaner verlieren die Mehrheiten im Abgeordnetenhaus und im Senat. Die Mehrheit der Abgeordneten könnte ein „Impeachment“-Verfahren gegen Trump einleiten und er könnte dann von zwei Dritteln der (anwesenden) Senatoren seines Amtes enthoben werden. Auch wenn es nicht soweit kommen sollte, würde der Präsident zumindest dabei gebremst, die Weltmacht Amerika weiter und auch weit über seine Amtszeit hinaus radikal zu verändern: Etwa durch parlamentarische Kontrolle seiner (Außen-) Politik und Personalbenennungen, nicht zuletzt bei der Besetzung von Richtern auf Lebenszeit.
▶︎ Ein fünftes Szenario würde eintreten, wenn Gefahr in Verzug ist: sei es durch eine internationale Krise oder wenn Oberbefehlshaber Trump selbst einen präventiven Waffengang befehlen sollte, etwa gegen Nordkorea oder den Iran. Dann würde die institutionell eigentlich starke Position des Kongresses ausgehebelt – ungeachtet der Mehrheitsverhältnisse in den beiden Kammern.
Sollte dieses Kriegsszenario bereits vor den Wahlen eintreten, würden die Chancen steigen, dass Trump, ähnlich wie es zuvor bereits Georg W. Bush durch Instrumentalisierung des globalen Krieges gegen den Terrorismus gelang, ein historisch etabliertes Muster durchbricht, wonach Präsidenten bei den ersten Zwischenwahlen Sitze und Mehrheiten im Kongress verlieren. Mit anderen Worten: Angesichts einer nationalen Sicherheitsbedrohung könnten die US-Wählerinnen und Wähler im Zuge einer „rally around the flag“, einer patriotischen Sammelbewegung um den Oberbefehlshaber der Streitkräfte, auf ihre Möglichkeit der Gewaltenkontrolle durch die Kongresswahlen verzichten.
Um die Plausibilität dieser Szenarien zu verdeutlichen, werden im Folgenden der institutionelle Rahmen und die Machtarchitektur des politischen Systems der USA skizziert.[1]
1. Macht-Architektur der US-amerikanischen Verfassung
Um einen Machtmissbrauch zu verhindern, haben die Architekten der US-amerikanischen Verfassung mehrere Kontrolldimensionen verankert: Erstens verleiht der Souverän, das heißt der wahlberechtigte Bürger, die Macht an seine Repräsentanten nur auf Zeit (temporale Machtkontrolle), damit diese ihm Rechenschaft schuldig bleiben. Zweitens verlangt die föderale Struktur, die Machtbefugnisse der den Bürgern näherstehenden Einzelstaaten mit jenen des Gesamtstaates in Einklang zu bringen (vertikale Machtkontrolle) – die jedoch hier nicht weiter erörtert wird. Drittens gibt es sowohl auf einzelstaatlicher Ebene als auch auf der Ebene des Gesamtstaates eine Teilung der Gewalten in Legislative, Exekutive und Judikative (horizontale Machtkontrolle).
1.1 Horizontale Gewaltenkontrolle
Der zentrale Unterschied zwischen dem US-amerikanischen (Präsidialsystem) „checks and balances“-System und parlamentarischen Regierungssystemen wie dem der Bundesrepublik Deutschland liegt in der unterschiedlichen Beziehung zwischen der Legislative und der Exekutive begründet (vgl. Tabelle 1).[2] Anders als der US-Präsident, der durch eine landesweite Wahl persönlich gewählt wird und damit eigene Legitimation beanspruchen kann, wird die deutsche Kanzlerin mittelbar von der Mehrheit im Parlament bestimmt. Auch in der politischen Auseinandersetzung muss die Spitze der deutschen Exekutive darauf vertrauen können, dass ihre politischen Initiativen von ihrer Fraktion bzw. Koalition im Bundestag mitgetragen werden. Die Stabilität sowohl der Regierung/der Exekutive als auch die der Parlamentsmehrheit hängt von einer engen und vertrauensvollen Kommunikation zwischen beiden ab.[3] Diese „Gewaltenverschränkung“ charakterisiert parlamentarische Regierungssysteme.
| Tabelle 1: Strukturmerkmale parlamentarischer und präsidentieller Regierungssysteme | ||
| Merkmal | parlamentarisch (z.B. BRD) | präsidentiell (z.B. USA) |
| Legitimation | nur Parlament direkt gewählt | Präsident und Parlament mit jeweils eigener Legitimation |
| Organisation der Gewaltenkontrolle | Gewaltenverschränkung | Trennung von Regierung und Parlament |
| Politische Abberufbarkeit der Regierung | ja | nein (nur verfassungsrechtlich, „impeachment“) |
| Parlamentsauflösungsrecht der Exekutive | ja | nein |
| Regierungsmandat und Parlamentsmandat | vereinbar | unvereinbar |
| Partei- und Fraktionsdisziplin | stark | schwach |
Quellen: Walter Bagehot, The English Constitution, Ithaca (1867) 1966; Ernst Fraenkel, Das amerikanische Regierungssystem, Köln/Opladen 1960; Winfried Steffani, Parlamentarische und präsidentielle Demokratie: Strukturelle Aspekte westlicher Demokratien, Opladen 1979, S. 39-104.
Legislative und Exekutive sind im politischen System der USA nicht nur durch verschiedene Wahlakte stärker voneinander „getrennt“. Das System der „checks and balances“ ist darüber hinaus dadurch gekennzeichnet, dass die politischen Gewalten miteinander konkurrieren und sich gegenseitig kontrollieren (vgl. Abb. 1).[4] Der US-amerikanische Kongress übernimmt somit nicht automatisch die politische Agenda der Exekutive bzw. des Präsidenten, selbst wenn im aktuellen Fall des „unified government“ das Weiße Haus (Sitz des Präsidenten) und Capitol Hill (Sitz des Kongresses) von der gleichen Partei „regiert“ werden. Noch weniger ist dies der Fall, wenn bei einem „divided government“ Präsident und Kongress von unterschiedlichen Parteien „kontrolliert“ werden,[5] was in den Kongresswahlen am 6. November eintreten könnte: wenn etwa im eingangs skizzierten Szenario vier die Mehrheiten beider Kammern oder in den Szenarien zwei und drei in einem sogenannten „split Congress“ eine der beiden Kammern an die Demokraten gehen sollten.
Abbildung 1: Vergleich der politischen Systeme der USA und Deutschlands
 Quelle: Josef Braml, Politisches System der USA, Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, 2013, S. 8.
Quelle: Josef Braml, Politisches System der USA, Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, 2013, S. 8.
Während im US-System die Legislative als Ganzes mit der Exekutive um Machtbefugnisse konkurriert,[6] ist „Opposition“ im parlamentarischen System auf die Minderheit im Parlament beschränkt, die nicht die Regierung trägt (vgl. Abb. 1). Insbesondere für die Regierungspartei/-koalition sind Partei- bzw. Fraktionsdisziplin grundlegend erforderlich, um die Funktionsfähigkeit der eigenen Regierung, ja des parlamentarischen Regierungssystems insgesamt zu gewährleisten. Da Exekutive und Parlamentsmehrheit in einer politischen Schicksalsgemeinschaft verbunden sind, haben einzelne Abgeordnete ein Eigeninteresse, bei wichtigen Abstimmungen nicht von der Parteilinie abzuweichen und sich der Fraktionsdisziplin zu fügen. Wahlverfahren, Parteienfinanzierung, Kandidatenrekrutierung und die hohe Arbeitsteilung im Parlament geben weitere Anreize für parteidiszipliniertes Verhalten.[7]
Dagegen ist in den USA die politische Zukunft einzelner Abgeordneter und Senatoren weitgehend unabhängig von der des Präsidenten; ihre (Wieder-) Wahlchancen hängen vorrangig vom Rückhalt im eigenen Wahlkreis bzw. Einzelstaat ab. Aufgrund des Wahlsystems und der Politikfinanzierung sind sie als „politische Einzelunternehmer“ („political entrepreneurs“) in den USA primär selbst für ihre Wiederwahl verantwortlich und haften gegebenenfalls auch persönlich für ihr Abstimmungsverhalten im Kongress, weil sie sich gegenüber Interessengruppen und Wählerschaft nicht hinter einer Parteidisziplin verstecken können. Den US-Parteien fehlen in der legislativen Auseinandersetzung Ressourcen und Sanktionsmechanismen, um den Gesetzgebungsprozess im Sinne einer Parteidisziplin zu gestalten.[8]
Ebenso wenig kann der US-Präsident auf Parteidisziplin zählen. Der Kopf der Exekutive kann selbst keine Gesetzesvorlagen einbringen und benötigt bei Initiativen gleichgesinnte Abgeordnete und Senatoren. Daher ist er im Gesetzgebungsprozess laufend gefordert (und gelegentlich überfordert), im Kongress durch Anreize für die Zustimmung zu seiner Politik zu werben. Je nach Politikinitiative muss er unterschiedliche und zumeist parteiübergreifende Ad-hoc-Koalitionen schmieden.
Kongressabgeordnete und Senatoren haben im politischen System der Vereinigten Staaten, anders als die parteidisziplinierten Abgeordneten in parlamentarischen Regierungssystemen, allgemein eine sehr starke, institutionell fundierte Machtstellung gegenüber der Exekutive – insbesondere auch durch ihre Aufsicht („oversight“) und Organisationsgewalt gegenüber der Administration, dem Verwaltungsapparat des Präsidenten.
1.2 Präsident und Administration: die Exekutive
Im Vergleich zur überschaubaren und hierarchisch organisierten deutschen Ministerialbürokratie erscheint die US-Behördenstruktur als unübersichtlicher Wildwuchs von Organisationseinheiten. Die deutsche Kanzlerin steht an der Spitze des Kabinetts, sie gibt das Regierungshandeln vor (Artikel 65 Grundgesetz: Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers) und ihr sind unter Berücksichtigung des Ressortprinzips auch die Ministerien und deren Bürokratie untergeordnet. Dagegen hat der US-Präsident viel größere Schwierigkeiten, seine Exekutive zu leiten. Enorme Anstrengungen, um die eigene Linie in einem Interessengeflecht rivalisierender Ministerien und Regierungsstellen durchzusetzen, gehören zum mühsamen Tagesgeschäft des Chefs der Bundesverwaltung. Die einzelnen Behörden wurden oftmals ad hoc, aus politischen Anlässen oder infolge von Krisen gegründet und nicht etwa in das bestehende Organigramm eingegliedert, sondern hinzugefügt. Die daraus entstandene fragmentierte Struktur ist gewollt, denn sie bietet Außenstehenden vielfältige Möglichkeiten der Einflussnahme.
Die US-Verwaltung ist geprägt durch ein intensives Kompetenzgerangel zwischen Exekutive und Legislative, wenn es darum geht, wichtige Positionen zu besetzen, die Behörden finanziell auszustatten sowie deren Aufgaben vorzugeben bzw. zu kontrollieren. Zwar liegt die exekutive Gewalt beim Präsidenten. Laut Verfassung (Artikel III, Absatz 1) muss er dafür sorgen, dass die Gesetze „gewissenhaft“ vollzogen werden. Er kann dazu unter anderem auch die Führungsspitzen der Ministerien und Bundesbehörden nominieren. Doch müssen diese von der Legislative, namentlich vom Senat, gebilligt werden. Dem Kongress obliegt auch die Organisationsgewalt, sprich die Befugnis, die Bundesbehörden zu errichten und zu finanzieren.
Diese „Macht der Geldbörse“ („power of the purse“) führt seit jeher zu informellen Absprachen zwischen den Geldgebern im Kongress und den Empfängern in der Verwaltung (vgl. Abb. 2).
Abbildung 2: Eisernes Dreieck („Iron Triangle“)

- (1) Wahlkampffinanzierung und Information
- (2) Finanzierung und politische Unterstützung
- (3) Regierungsaufträge und lockere Regulierung/Deregulierung
- (4) Lobbyarbeit, um Unterstützung des Kongresses zu mobilisieren
- (5) Wohltaten für Wahlkreise und Einzelstaaten
- (6) Zugang und Wohlwollende Gesetzgebung/Aufsicht
Quelle: Josef Braml, Politisches System der USA, Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, 2013, S. 14.
Unabhängig vom Ausgang der anstehenden Kongresswahlen und der jeweiligen Parteizugehörigkeit hat diese systematisch angelegte Interessenverquickung Auswirkungen auf das Verhalten der Kongressmitglieder. Insbesondere die für die Finanzierung verantwortlich zeichnenden Abgeordneten und Senatoren zuständiger Kongressausschüsse bewachen mit Argusaugen ihre Pfründe, die auch ihre Wiederwahl sichern helfen. Denn ihr politisches Schicksal hängt letztlich davon ab, wie sehr sie die Partikularinteressen in ihren Wahlkreisen bzw. Einzelstaaten bedienen können, insbesondere jene von ihnen nahestehenden Interessengruppen, die ihre immer teurer werdenden Wahlkämpfe finanzieren.
Jeder Präsident ist deshalb gut beraten, einen eigenen, nur ihm gegenüber loyalen Beraterstab um sich zu scharen, um in diesem Interessengeflecht seine politische Linie durchzusetzen – nicht zuletzt auch gegenüber der Verwaltung „seiner“ Exekutive. Denn die Auseinandersetzungen in den Reihen der Exekutive sind nicht minder heftig. Auf der einen Seite versuchen die sogenannten „Männer und Frauen des Präsidenten“, also der Regierungsapparat, die Politikinitiativen des Weißen Hauses voranzutreiben. Auf der anderen Seite bremst der Verwaltungsapparat sie immer wieder aus. Die relativ autonomen Ministerien und Behörden versuchen, unabhängig vom jeweiligen Präsidenten und von der jeweiligen parteipolitischen Konstellation ihre eigenen institutionellen Besitzstände zu wahren.
Das tun sie umso mehr, seitdem Trumps damaliger Chefstratege Stephen Bannon den „Rückbau des Verwaltungsstaates“ („deconstruction of the administrative state“) angekündigt hatte.[9] Dazu wurde vom Weißen Haus eine Art Schattenkabinett eingerichtet und vertraute Mitarbeiter wurden eingesetzt, die auf höchster Ebene in die Arbeitsabläufe der Ministerien eingebunden sind. Sie sind aber nicht dem jeweiligen Minister, sondern nur einem Aufsichtskoordinator weisungsgebunden, zunächst dem damaligen stellvertretenden Stabschef im Weißen Haus, Rick Dearborn.[10]
Dass Trumps Regierungsmaschine nicht reibungs- und geräuschlos läuft, darauf verweisen nunmehr auch seriöse Abhandlungen, etwa Bob Woodward in seinem aktuellen Buch „Fear“: Demnach arbeiten selbst hochrangige Kabinettsangehörige, etwa der Stabschef im Weißen Haus, John Kelly, sowie Verteidigungsminister James Mattis, gegen die „Neigungen“ des Präsidenten, um Schlimmeres zu verhindern.[11]
Trumps Misstrauen ist umso größer geworden, seitdem ein Unbekannter in einem Gastbeitrag in der New York Times schrieb: „Ich bin Teil des Widerstands innerhalb der Regierung Trump. Ich arbeite für den Präsidenten, aber gleichgesinnte Kollegen und ich haben gelobt, Teile seiner Agenda und seine schlimmsten Neigungen zu vereiteln.“[12]
Schon seit längerem sieht sich Trump von vermeintlichen „Verrätern“ und „Spionen“ umgeben. Ende Mai 2018 verlangte er sogar, dass das Justizministerium untersucht, ob der Geheimdienst FBI oder das Ministerium selbst sein Wahlkampfteam „aus politischen Gründen infiltriert oder überwacht“ hätten. Schnell war bei Trumps Anhängern von einer Verschwörung die Rede[13] – auch Trump selbst glaubt an solche Theorien.[14] Trump spricht den eigenen Geheimdiensten öffentlich sein Misstrauen aus, bezeichnet sie als „deep state“, als unkontrollierten Staat im Staate, die ihm das Handwerk legen wollen, weil er zum Wohle seiner Bewegung gegen das Washingtoner Establishment und die Bürokratie vorgehe.[15]
Bislang sind jedoch alle Vorhaben misslungen, den Verwaltungsapparat merklich zu verkleinern. So scheiterte Anfang der 1970er-Jahre Präsident Richard Nixon (1969-1974) mit seinem Versuch, durch einen radikalen Umbau „anti-präsidiale Nischen“ in der Exekutive zu eliminieren. Mit seinem Dezentralisierungsprogramm des „New Federalism“ wollte eine Dekade später Präsident Ronald Reagan (1981-1989) das „Big Government“ in Washington verkleinern – ohne nachhaltigen Erfolg. Trumps Vorgänger Barack Obama war ebenso bemüht, den Regierungsapparat schlanker und effizienter zu machen. Bereits im Januar 2012 hatte der Präsident den Kongress ersucht, die handelspolitischen Aufgaben von sechs Regierungseinheiten, darunter des Handelsministeriums und des Büros des Handelsbeauftragten, in einer neuen Behörde zusammenzufassen. Doch die symbiotischen Dreiecksbeziehungen, das „eiserne Dreieck“ (vgl. Abb. 2) zwischen den betroffenen Einheiten der Exekutive, der Wirtschafts- und Handelslobby und den federführenden Ausschüssen im Kongress, haben auch Obamas ehrgeizige Neuorganisation vereitelt.
Die persönlichen Mitarbeiter des Präsidenten – die er ohne Zustimmung des Senats frei auswählen kann – sind seine engsten Vertrauten in den Machtkämpfen, die mit dem Begriff „bureaucratic politics“ verharmlosend umschrieben werden. Die Getreuen und einflussreichsten Berater des Präsidenten – unter anderem Donald Trumps Tochter Ivanka und sein Schwiegersohn Jared Kushner – sind im „White House Office“ zu finden. Sie genießen auch ein „exekutives Privileg“, das heißt, sie sind der Legislative keine Rechenschaft schuldig und können es auch verweigern, vor Kongressausschüssen angehört zu werden.
Die anderen, dem Präsidenten ebenso nahestehenden Leiter der Einheiten des „Executive Office of the President“ müssen jedoch vom Senat abgesegnet werden und der Legislative auch nach ihrer Bestätigung laufend Rede und Antwort stehen. Dazu hätten sie reichlich Gelegenheit, wenn es den Demokraten bei den Kongresswahlen gelingt, wie in den Szenarien drei und vier eingangs skizziert, die dafür entscheidende Kongresskammer, namentlich den Senat für sich zu entscheiden. Ebenso wie bei diesen Personalentscheidungen müsste der Präsident auch bei der Besetzung der Ministerämter dann umso mehr die Machtkalküle der „anderen politischen Gewalt“, also die Interessen des Kongresses, berücksichtigen.
1.3 Die „Macht der Geldbörse“: die Legislative
Die Legislative und ihre Befugnisse sind in der US-Verfassung – noch vor dem Präsidenten und dessen Aufgaben – an erster Stelle angeführt. Artikel I, Absatz 1 bestimmt: „Die gesetzgebende Gewalt ruht im Kongress der Vereinigten Staaten, der aus einem Senat und einem Abgeordnetenhaus besteht.“
Der Kongress ist das zentrale Verfassungsorgan bei der Gesetzgebung – auch wenn die beiden anderen politischen Gewalten mitwirken: der „Supreme Court“ durch die Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen und der Präsident durch sein Vetorecht. Der Präsident hat zwar selbst kein Initiativrecht und kann nur mittelbar über gleichgesinnte Abgeordnete und Senatoren Gesetzesvorlagen auf den Weg bringen. Er hat jedoch das „letzte“ Wort: Damit eine Vorlage („bill“) zum Gesetz („law“) wird, muss der Präsident sie unterzeichnen. Er kann auch auf den laufenden Gesetzgebungsprozess Einfluss nehmen, indem er sein suspensives (aufschiebendes) Veto ausspricht oder damit droht. Sein Einspruch kann nur von jeweils einer Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern des Kongresses überstimmt werden – was sehr selten möglich ist.
Auch die Legislative hat Möglichkeiten, die ausführende Gewalt zu kontrollieren, also ihr Recht auf „oversight“ auszuüben: Bei schweren Verfehlungen, sogenannten „high crimes and misdemeanors“, kann der Senat nach Aufnahme eines Verfahrens durch das Abgeordnetenhaus sogar den Präsidenten seines Amtes entheben („impeachment“). Völkerrechtlich bindende Vertragsunterzeichnungen des Präsidenten gelten erst, wenn sie vom Senat ratifiziert worden sind. Der Senat muss ferner präsidentiellen Personalernennungen für höhere Ämter wie Richter, Botschafter, Minister und weitere Spitzenbeamte zustimmen.
Zwar kann der Präsident den Rat und die Zustimmung („advice and consent“) des Senats umgehen, indem er Kandidaten außerhalb der Sitzungsperiode, das heißt über ein sogenanntes „recess appointment“, ernennt. Doch deren Amtszeiten enden dann mit der jeweiligen Legislaturperiode, und sie bekommen bei ihrer Amtsausübung den Unmut der Senatoren zu spüren. Denn das wirksamste politische Kontrollmittel ist die Macht der Geldbörse („power of the purse“). Das heißt, der Kongress muss bzw. darf die Haushaltsmittel insbesondere auch jene für Exekutivorgane bewilligen.
Die unterschiedlichen Wahlzyklen des Präsidenten und des Kongresses ermöglichen eine weitere Facette der Machtkontrolle, nämlich eine „geteilte Regierung“. Mit den Kongresswahlen 2018 könnte einmal mehr eine solche Konstellation („divided government“) etabliert werden. Das heißt, dass die Partei, die den Amtsinhaber im Weißen Haus stellt, nicht über Mehrheiten im Kongress verfügt (vgl. Übersicht möglicher Szenarien nach den Kongresswahlen in der Tabelle 2).
| Tabelle 2: Gewicht legislativer Hauptfunktionen bei möglichen Wahlausgangsszenarien | |||
| Mögliche Szenarien nach Kongresswahlen | Gesetzgebung | Personalbestätigung (nur Senat relevant) | Kontrolle, bis hin zur Amtsenthebung |
| Szenario 1: H: R / S: R Die Republikaner behalten die Mehrheiten im Abgeordnetenhaus und im Senat. | Noch weniger Mitsprache und „innerer Widerstand“ bei Republikanern, besonders nach dem Ausscheiden von „Speaker“ Paul Ryan im Abgeordnetenhaus und Trumps Widersachern im Senat: Jeff Flake und Bob Corker | Der Senat wird präsidentiellen Personalernennungen für höhere Ämter wie Richter, Botschafter, Minister und weitere Spitzenbeamte wie bisher mehr oder weniger vorbehaltlos zustimmen. | Noch weniger „Oversight“, sprich Untersuchungsausschüsse gegen Präsident Trump und seine Kabinettsmitglieder als bisher |
| Szenario 2: H: D / S: R Die Republikaner verlieren nur das Abgeordnetenhaus, verteidigen aber ihre Senatsmehrheit. | Größere Schwierigkeiten, etwa eine Grenzmauer zu finanzieren; aber leichteres Spiel, die Demokraten im Abgeordnetenhaus für kreditfinanzierte Infrastrukturprojekte zu gewinnen | Wie bisher, da Abgeordnetenhaus bei Personalernennungen irrelevant ist | Mehr Untersuchungsausschüsse im Abgeordnetenhaus gegen Trump und sein KabinettZwar ist die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens durch Abgeordnetenhaus möglich; doch die Beschließung durch den Senat unwahrscheinlich |
| Szenario 3: H: R / S: D Die Republikaner verlieren nur die Senatsmehrheit, verteidigen aber ihre Mehrheit im Abgeordnetenhaus. | Schwierigkeiten bei der Grenzmauer-Finanzierung mit Demokraten im Senat sowie bei kreditfinanzierten Infrastrukturmaßnahmen mit dem weiterhin von libertären Republikanern kontrollierten Abgeordnetenhaus | Blockade vieler Personalernennungen des Präsidenten; insbesondere bei Richternominierungen für das Oberste Gericht | Mehr Untersuchungsausschüsse im Senat gegen Trump und sein KabinettEröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump wenig wahrscheinlich |
| Szenario 4: H: D / S: D Die Republikaner verlieren die Mehrheiten im Abgeordnetenhaus und im Senat. | „Gridlock“: Blockade sämtlicher Gesetzesvorhaben – mit Ausnahme des Infrastrukturprogramms; bei Haushaltsstreits ist ein Stillstand der Regierungsgeschäfte („Government Shutdown“) möglich | Blockade vieler Personalernennungen des Präsidenten; insbesondere bei Richternominierungen für das Oberste Gericht | Mehr Untersuchungsausschüsse beider Kammern gegen Trump und sein KabinettErfolgreiches „Impeachment“ möglich, falls Sonderermittler Mueller noch Belastendes gegen Trump vorbringt |
Während der Präsident im Falle einer geeinten Regierung („unified government“) im Sprecher des Abgeordnetenhauses („speaker of the house“) meistens einen Verbündeten hat, der ihm hilft, Mehrheiten für seine politischen Initiativen zu organisieren, ist dieser im Falle eines „divided government“ sein schärfster Widersacher.
Sollten die Demokraten die Mehrheit im Abgeordnetenhaus zurückerobern, könnte Nancy Pelosi wieder „Madame Speaker“ werden – eine Rolle die sie schon (von 2007 to 2011) ausfüllte und mit der sie als erste Frau in diesem wichtigen Amt amerikanische Geschichte schrieb. Ihre Kandidatur wäre nicht unumstritten, zumal eine Reihe jüngerer Demokratinnen bereits eine jüngere Parteiführung angemahnt haben.
Seitdem Paul Ryan, der aktuelle Sprecher des Abgeordnetenhauses, bekanntgab, dass er nicht mehr zur Wiederwahl antritt, wird auch bei den Republikanern um die Rangordnung gekämpft. Der Wettbewerb zwischen den Nächstplatzierten, dem Mehrheitsführer („majority leader“) Kevin McCarthy und dem Fraktionsvorsitzenden („majority whip“) Steve Scalise, sowie Jim Jordan, dem Kopf des libertären Tea-Party-Flügels, würde sich zu einem Machtkampf steigern, falls die Republikaner wider Erwarten doch ihre Mehrheit im Abgeordnetenhaus verteidigen.
Zwar verfügt der Sprecher des Abgeordnetenhauses wegen der fehlenden Partei- und Fraktionsdisziplin nicht über die enormen Sanktionsmittel eines Fraktionschefs in einem parlamentarischen Regierungssystem wie in Deutschland. Der US-Präsident kann sich mit entsprechenden Hilfen für die Wahlkreise oder Einzelstaaten der umworbenen Abgeordneten und Senatoren sogar Kongressmitglieder der anderen Partei „kaufen“. Doch hat auch der „speaker“ Mittel zur Verfügung, um die Mehrheit seiner Parteifreunde auf Linie zu halten: Er kann die für Interessengruppen und deren Zuwendungen besonders attraktiven Vorsitzenden von Ausschüssen und Unterausschüssen bestimmen, über einen Verfahrensausschuss, das „rules committee“, regeln, ob und in welchen Ausschüssen bzw. Unterausschüssen ein Gesetz behandelt wird, und festlegen, inwieweit Änderungsanträge („amendments“) zulässig sind und welche Prozeduren zu erfolgen haben. Die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses gibt dem Sprecher also wirksame Machtinstrumente an die Hand.
Erheblich schwieriger ist es, den Senat zu führen. In dieser Kammer kann ein einziger Senator mit Dauerreden, einem sogenannten „filibuster“, den Geschäftsbetrieb aufhalten – solange ihm nicht eine qualifizierte Dreifünftelmehrheit von 60 Senatoren den Mund verbietet. „To invoke cloture“ lautet das Manöver, um ein filibuster abzuwenden.
Deshalb gilt es, im Senat, Anreize zu geben, um möglichst alle 100 Senatorinnen und Senatoren zufriedenzustellen. Mit Druck würde man hingegen wenig bewirken. Nach der „Macht“ des Mehrheitsführers im Senat gefragt, erwiderte der ehemalige demokratische Senator und „majority leader“ George J. Mitchell: „Man hat die Macht, 99 Hintern zu küssen.“[16]
Um dieses schwierige Amt ist der aktuelle Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, nicht zu beneiden, zumal sich die meisten seiner Kollegen ohnehin für eine höhere Aufgabe, nämlich für die Präsidentschaft, berufen fühlen und dieses Amt mit Donald Trump von einem ebenso Machtbewussten besetzt ist. Sollten die Demokraten, die beim Wahlgang am 6. November mehr Sitze zu verteidigen haben, wider Erwarten doch die Mehrheit zurückgewinnen, hätte der derzeitige Minderheitenführer („minority leader“) Charles Schumer die schwierige Aufgabe, die Senatoren auf eine politische Linie zu bringen – ein Unterfangen, das gerne ironisch mit der Redewendung beschrieben wird: „It’s like herding cats“.
Die historisch tradierte, die Machtposition jedes einzelnen der Senatoren aufwertende hohe Hürde von 60 Stimmen, um eine Blockade aufzuheben, gilt immer noch für das normale Gesetzgebungsverfahren. Diese parlamentarische Kontrollmöglichkeit besteht jedoch nicht mehr bei Personalbenennungen des Präsidenten, etwa für Ministerämter oder das Oberste Gericht.
Seitdem die – wenig strategisch handelnden – Demokraten im November 2013 mit ihrer einfachen Mehrheit kurzerhand die Geschäftsordnung des Senats veränderten – sich für die von den Republikanern sogenannte „nukleare Option“ entschieden –, können Blockademanöver bei Personalbenennungen nunmehr mit einer einfachen Mehrheit von 51 Stimmen aufgehoben werden. Das war nur solange von Vorteil für die Demokraten, als sie selbst in der Mehrheit waren und ihrem Parteifreund und Präsidenten Barack Obama im Weißen Haus ermöglichen konnten, die Blockade seiner Personalbenennungen aufzuheben.
Als sich bei den Wahlen im November 2014 jedoch das Blatt wendete, hat die neue Mehrheit der Republikaner – dem Vorbild der vorherigen Mehrheit der Demokraten folgend – dann ihrerseits und umso weitgehender die Kontrollmöglichkeiten der jetzt demokratischen Minderheit eingeschränkt. Nun haben sie selbst bei den noch wichtigeren Nominierungen für das Oberste Gericht keine Möglichkeit mehr, durch Dauerreden („filibuster“) aus ihrer Sicht unqualifizierte und radikale Kandidaten zu verhindern.
1.4 Die Judikative: Wenn die Waffen sprechen, schweigen die Gesetze
Jede Neubesetzung von Richterämtern am „Supreme Court“ durch den Präsidenten kann sich mit einer möglichen Veränderung der Mehrheitsverhältnisse auch grundlegend auf Entscheidungen auswirken, die die Qualität der amerikanischen Demokratie und Gesellschaft bestimmen. So konnten die Obersten Richter auch eine der größten Verfassungskrisen der jüngsten US-amerikanischen Geschichte entschärfen, indem sie im Fall Bush v. Gore am 12. Dezember 2000 den Ausgang der heftig umstrittenen Präsidentschaftswahl zugunsten des Republikaners George W. Bush und damit gegen seinen Herausforderer Al Gore entschieden.
Trotz dieses hoch umstrittenen Urteils genießt das Oberste Gericht in der US-Bevölkerung höchste Autorität. Seine Zustimmungsraten übertreffen bei Weitem die Werte der anderen politischen Gewalten, namentlich des Kongresses und des Präsidenten (vgl. Abb. 3).
Abb. 3: Zustimmungsraten (in Prozent) für Oberstes Gericht, Präsident und Kongress

Quelle: Gallup, Mitte Juli 2018
Doch sind auch die Rechtsprechungen des Obersten Gerichts nicht in Stein gemeißelt. Im Laufe der Entwicklung der USA von einer Agrar- über eine Industrie- hin zu einer Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft mussten die Richter immer wieder neue Realitäten mit den (interpretierbaren) Verfassungsgrundsätzen in Einklang bringen.
Gleichwohl ist die Interpretationsfähigkeit des Verfassungstextes bis heute umstritten. Während die einen den Text der Verfassung nur gemäß der „ursprünglichen Absicht“ („original intent“) ihrer Gründerväter auslegen wollen, sehen die anderen im Verfassungstext ein „lebendes Dokument“ („living document“). Dementsprechend fordern erstere juristische Zurückhaltung („judicial restraint“) und verurteilen den Standpunkt der anderen Gruppe, die weite rechtliche Auslegung, als Aktionismus („judicial activism“).
Wenig Interpretationsspielraum haben die Gerichte, wenn Gefahr in Verzug ist: Vor allem in Krisen- und Kriegszeiten hält sich das Oberste Gericht als nicht politische Instanz eher zurück; es will dem Obersten Befehlshaber nicht in den Arm fallen. Solange der Krieg gegen den Terrorismus andauert – und Amerika sieht sich zudem auch wieder von „revisionistischen Mächten“ wie Russland und China bedroht –, wird im politischen System der Vereinigten Staaten wohl weiterhin die römische Maxime gelten: „Inter arma silent leges“ („Unter Waffen schweigen die Gesetze.“).[17]
Nicht wenige Beobachter sehen in dieser Praxis aus verfassungsrechtlicher Warte hingegen ein gefährliches Wagnis, bei dem die im politischen System der USA fest verankerten Prinzipien der „checks and balances“ ausgehebelt zu werden drohen. Kenntnisse der amerikanischen Geschichte begründen diese Befürchtungen: In einer eingehenden Analyse mit dem Titel „All the Laws but One: Civil Liberties in Wartime“ warnte William Rehnquist, bis zu seinem Tode Anfang September 2005 Oberster Richter („Chief Justice“) des „Supreme Court“, bereits 1998 vor der Gefahr, dass der Oberste Befehlshaber in Kriegszeiten durch zusätzliche Machtbefugnisse dazu verleitet wird, den konstitutionellen Rahmen zu überdehnen.
Die Frage, ob die Rechtsprechung der Exekutive ihre Grenzen aufzeigen könnte, beurteilte der Oberste Richter skeptisch: „Wenn die (höchstrichterliche) Entscheidung getroffen wird, nachdem die Kriegshandlungen beendet sind, ist es wahrscheinlicher, dass die persönlichen Freiheitsrechte favorisiert werden, als wenn sie getroffen wird, während der Krieg noch andauert“, erklärte Rehnquist.[18]
Rehnquists Lehren aus der amerikanischen Rechtsgeschichte sind sehr bedenklich, weil auch der Kongress im Laufe der amerikanischen Geschichte immer wieder dabei versagt hat – zuletzt beim Irakkrieg –, die militärische Gewalt des Präsidenten als Oberbefehlshaber der Streitkräfte zu kontrollieren.
Denn die Sorge der Legislative um die institutionelle Machtbalance tritt in den Hintergrund, wenn Gefahr im Verzug ist. In Krisen- und Kriegszeiten steht der Präsident als Oberbefehlshaber im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ihm kommt die Rolle des Schutzpatrons zu. Der patriotische Sammlungseffekt („rally around the flag“) bedeutet einen immensen Machtgewinn und Vertrauensvorsprung für den Präsidenten und die Exekutive. Nicht zuletzt symbolisiert das Präsidentenamt die nationale Einheit, gilt das Weiße Haus als Ort der Orientierung, an dem in Krisenzeiten die Standarte hochgehalten wird.
US-Präsidenten konnten immer wieder nationale Krisen dazu nutzen, ihre Kompetenzen auch auf Kosten der beiden anderen politischen Gewalten auszuweiten, die Struktur des Regierungsapparats und der Verwaltung grundlegend zu verändern und auch politisches Kapital daraus zu schlagen.
2. Mögliche und wahrscheinliche Szenarien
Ein mögliches Kriegsszenario und die damit verbundene patriotische Sammlungsbewegung hinter dem Präsidenten und Oberbefehlshaber würde einmal mehr in der US-amerikanischen Geschichte eine enorme Machtfülle und Wahlkampfhilfe für den Präsidenten bedeuten: Um der externen Bedrohung zu begegnen, ist der Präsident auf inneren Zusammenhalt, also auch auf ein „unified government“, angewiesen. Die dominante Rolle des Oberbefehlshabers der Streitkräfte in einer nationalen Krise würde Trump auch vor seinem persönlichen Ohnmachtsszenario schützen: Verlöre er am 6. November beide Kammern im Kongress, könnte ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen ihn Erfolg haben. Zwischen diesen beiden im Folgenden ausgeführten möglichen Extremen, dem Allmachts- und dem Ohnmachtsszenario, sind zwei weitere Szenarien möglich. Das weniger wahrscheinliche ist, dass die Demokraten nicht die Mehrheit im Abgeordnetenhaus gewinnen, aber die weitaus schwierigere Senatsmehrheit erreichen. Viel wahrscheinlicher und deshalb hier ausgeführt ist, dass die Demokraten die Mehrheit im Abgeordnetenhaus, aber nicht die Senatsmehrheit gewinnen.
2.1 „Rally around the flag“: Ein Kriegsszenario als mögliche Wahlkampfhilfe
Trumps neuer Nationaler Sicherheitsberater John Bolton, der bereits unter George W. Bush diente, wird sich noch an den Erfolg erinnern, den der „Global War on Terror“ seinerzeit seinem Präsidenten und Obersten Befehlshaber bei den Zwischenwahlen 2002 bescherte.[19]
Dieser Wahlerfolg wäre ohne äußere Bedrohung wenig wahrscheinlich gewesen: Legt man historische Analysen zugrunde, so büßt die Partei des Präsidenten bei Zwischenwahlen in der Regel an Wählerstimmen ein – tendenziell umso weniger, je höher die Zustimmungsrate für den Präsidenten ist. Selbst bei der hohen Zustimmungsrate („job approval“) für Bush von 63 Prozent war zu erwarten, dass seine Partei immerhin noch sieben bis zehn Sitze im Repräsentantenhaus verlieren würde. Die Zustimmungsrate des Präsidenten allein vermochte also nicht den Erfolg zu erklären.
Der 11. September 2001 hat sicherlich nicht nur die Zustimmung für den Präsidenten verstärkt, sondern auch die Ausgangslage und Dynamik bei den Wahlen beeinflusst. Neben der Wirtschaft hat sich im Verlauf des Wahljahres der Kampf gegen den Terrorismus bzw. die nationale Sicherheit als der dringendste Problembereich in den Köpfen der Amerikaner verfestigt.
Nicht signifikant für das Ergebnis dieser Zwischenwahlen war letztendlich jedoch der Faktor Wirtschaft.[20] Beim zweiten, entscheidenden Thema, der Terrorismusbekämpfung, fühlten sich die Amerikaner weitaus besser bei den Republikanern aufgehoben.[21] So war es auch nicht überraschend, dass diejenigen, die den Terrorismus als wichtigsten Themenbereich identifizierten, mit einer überwältigenden Mehrheit angaben, dass sie für die Republikaner votieren würden: 81 Prozent versus 19 Prozent für einen Kandidaten der Demokraten.[22]
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die nationale Sicherheitsbedrohung dem Präsidenten in seiner Rolle als Oberstem Befehlshaber eine historische Gelegenheit bot, auch im Kongresswahlkampf für die Unterstützung seiner Politik gegen den Terrorismus zu werben. Vor allem in den letzten zwei Wochen vor den Wahlen war George W. Bush in den entscheidenden Wahlkämpfen involviert. Allein in den fünf Tagen vor dem Wahltag war Bush in 15 sorgfältig ausgewählten Bundesstaaten vor Ort. Er machte dabei deutlich, dass er die Mehrheiten im Kongress benötige, um mit einem „united government“ Amerika besser verteidigen zu können.
Innerhalb der letzten zehn Tage wendete sich dann auch das Blatt. Hatten sich in der Gallup-Umfrage vom 21./22. Oktober noch 49 Prozent für einen Kandidaten der Demokraten ausgesprochen und nur 46 Prozent einen Republikaner befürwortet, war das Kräfteverhältnis im Meinungsbild der Umfrage vom 31. Oktober bis 3. November umgekehrt: 51 Prozent bekundeten ihre Absicht, einen Republikaner zu wählen, und nur 45 Prozent gaben an, ihre Stimme einem Demokraten geben zu wollen.
Der Wahlakt am 5. November 2002 bestätigte diese Tendenz. Präsident George W. Bush hatte danach die Möglichkeit, mit republikanischen Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses zu regieren, also mit erweiterten Handlungsoptionen.
Für den amtierenden Präsidenten Donald Trump mit seinen historisch niedrigen Zustimmungswerten wäre eine internationale Krise ebenso eine Chance, sich als Oberbefehlshaber profilieren zu können. Ähnlich wie George W. Bush nach den Terroranschlägen würde auch Donald Trump einen Vertrauensvorschuss erhalten. Zur Erinnerung: Obwohl es George W. Bush bei den heftig umstrittenen Präsidentschaftswahlen 2000 ebenso wenig wie Trump gelungen war, die Mehrheit der abgegebenen Wählerstimmen („popular vote“) zu erzielen, und obwohl auch seine Amtsführung in der Bevölkerung auf geteilte Zustimmung und zunehmend kritische Meinungen stieß, konnte sich der Präsident nach den Terroranschlägen auf ein großes Zutrauen seiner Landsleute stützen.
Der 11. September 2001 war für die Dynamik des innenpolitischen Machtgefüges kein konstituierendes Ereignis – wohl aber ein katalysierender und legitimierender Faktor.[23] Schon unmittelbar nach dem Amtsantritt ließen Präsident Bush und seine Entourage keinen Zweifel daran, dass sie die Position der Exekutive auf Kosten der Machtbefugnisse des Kongresses zu stärken beabsichtigten. Diese offensive Strategie des Weißen Hauses, den vor allem in der Amtszeit des Vorgängers Bill Clinton erstarkten Kongress wieder in eine untergeordnete Rolle zu drängen, erhielt mit den Terroranschlägen ihre Legitimation: Die amerikanische Bevölkerung war überzeugt, dass dies angesichts der nationalen Bedrohung rechtens, ja notwendig war. Im weltweiten Krieg gegen den Terrorismus konnte der Präsident nunmehr die dominante Rolle des Obersten Befehlshabers spielen.
Aber auch in der innenpolitischen Diskussion gelang es Präsident Bush, seine Diskurshoheit zu etablieren und sich als Schutzpatron zu gerieren, der die traumatisierte Nation vor weiteren Angriffen bewahrt. „Man kann die Tatsache nicht ignorieren, dass sich Amerika seit dem 11. September verändert hat […] und ich denke, dass dies auch einen Einfluss auf die Wahlentscheidung hatte“, sagte der damalige Mehrheitsführer im Senat, Trent Lott, unmittelbar nach dem Wahlerfolg vom 5. November 2002. Er leitete daraus den eindeutigen Appell an den Kongress ab: „unseren Präsidenten als den commander in chief zu unterstützen und mit ihm zu kooperieren“.[24]
In Kriegszeiten ist jeder einzelne, sonst in seinem politischen Handeln überwiegend sich selbst und seinen Wählern verantwortliche Abgeordnete aufgerufen, Partei für die nationale Sicherheit zu ergreifen. Obwohl amerikanische Abgeordnete grundsätzlich keine Parteisoldaten sind, stehen auch sie an der Seite des Obersten Befehlshabers, wenn es darum geht, ihm „patriotische Befugnisse“ im Krieg gegen äußere Feinde an die Hand zu geben und ihn bei der Verteidigung des „Heimatlandes“ zu unterstützen.
In dieser Lage wäre die Legislative schlecht beraten, ihr institutionelles Gegengewicht in die politische Waagschale zu werfen, um ihre Oppositionsrolle auszufüllen. Der Kongress hat in einer solchen Ausnahmesituation nicht das politische Gewicht, den Präsidenten im Krieg gegen einen äußeren Feind herauszufordern, würde er doch damit den Garanten der nationalen Einheit und Handlungsfähigkeit in Frage stellen.
Wer Donald Trumps Kriegsrhetorik ernst nimmt, muss annehmen, dass er als Präsident und Oberbefehlshaber ebenso alles in seiner Macht stehende unternehmen würde, um Amerika vor (potentiellen) Gefahren zu schützen, etwa eine nukleare Bedrohung durch den Iran zu beseitigen.
Schließlich hat man aus dem Nordkorea-Konflikt eine Lehre gezogen:[25] Wenn man zu lange wartet, gibt es keine Handlungsalternativen mehr. Für Nordkorea heißt das: Trump kann das nordkoreanische Regime nur noch eindämmen und dessen Nuklearkapazitäten nicht mehr mit Präventivschlägen verhindern. Im Wissen um die eigene militärische Stärke und die Verwundbarkeit amerikanischer Truppen in der Region kann die nordkoreanische Führung der Weltmacht die Stirn bieten. Wenn man die jüngste Geschichte sieht, etwa Trumps unilaterale Aufkündigung des Nukleardeals mit dem Iran, hat Pjöngjang ohnehin keinen Anreiz, mit Washington wirklich ernsthaft darüber zu verhandeln, seine Nuklearwaffen aufzugeben.
Anders sieht die Lage mit Blick auf das iranische Regime aus: Die USA könnten, nachdem sie das Nuklearabkommen mit dem Iran aufgekündigt haben, alsbald weitere Konsequenzen folgen lassen. Sollten Trump und seine Sicherheitsberater zu der Einschätzung kommen, dass der Iran Atombomben baut, werden sie schnell reagieren und Präventivschläge gegen den Iran führen oder zunächst Israel oder Saudi-Arabien dazu freie Hand lassen.
Dafür spricht auch ein neues mögliches Kriegskabinett in Washington: Trumps aktueller Außenminister Mike Pompeo ist, anders als sein Vorgänger Rex Tillerson, in der Iran-Frage ebenso ein Hardliner. Ex-Außenminister Tillerson hatte bis zu seiner Entlassung durch eine Twitter-Meldung des Präsidenten am Nuklearabkommen mit dem Iran festgehalten. An seiner Seite wusste er dabei die Mehrheit seiner europäischen Amtskollegen.
Trumps neuer Sicherheitsberater John Bolton fordert hingegen schon seit Längerem mit Bomben die iranische Atombombe zu verhindern: „To Stop Iran’s Bomb, Bomb Iran”.[26] Nachdem Bolton selbst im Kriegskabinett von George W. Bush noch von besonneneren Köpfen wie Condoleezza Rice und Colin Powell in Schach gehalten werden konnte, scheint nun die Stunde des Hardliners an der Seite des ebenso risikofreudigen Präsidenten gekommen zu sein.
2.2 Ohnmacht-Szenario verhindern, als Bollwerk Senatsmehrheit verteidigen
Ein weiteres alternatives Szenario wäre für Trump auch nicht ohne Risiko: Sollte Mueller bei seinen aktuellen Sonderermittlungen stichhaltige Beweise vorlegen können, dass Trumps Wahlkampfteam und der US-Präsident von den russischen Aktivitäten gewusst oder sogar gezielt mit russischen Agenten zusammengearbeitet haben, müssten auch die Abgeordneten und Senatoren im Kongress ernsthaft ein Amtsenthebungsverfahren erwägen.
Der erfahrene Sonderermittler Mueller – er war von 2001 bis 2013 Direktor des Federal Bureau of Investigation (FBI) – hält es für erwiesen, dass sich Russlands Agenten mit Hackerangriffen bei Trumps Wahl eingemischt haben.[27] Trump bezweifelt das: „Es könnten auch andere Leute gewesen sein. Es gibt viele Leute da draußen.“ Mit dieser vagen Andeutung eröffnete sich Trump weitere rhetorische Auswege und gab den Verschwörungstheorien seiner Anhänger erneut Nahrung.[28] Für den Fall, dass ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird, drohten Trumps publizistische Scharfmacher bereits unverhohlen mit Gewalt und prophezeiten einen Bürgerkrieg.[29]
Laut Steve Bannon, der gleich nach der Amtsübernahme Trumps den „Krieg“ mit dem „deep state“ prognostizierte, geht es nun um alles oder nichts. Dem ehemaligen Chefstrategen Trumps ist es gelungen, eine Gruppe anonymer Spender zu mobilisieren,[30] um das aus seiner Sicht Schlimmste zu verhindern: Sollten die Republikaner die Mehrheiten im Abgeordnetenhaus und im Senat verlieren, wäre auch das Weiße Haus vorzeitig in Gefahr und es könnte es für Trump eng werden, warnt Bannon.
Trump und die Republikaner werden alles daransetzen, vor allem die Mehrheit im Senat zu verteidigen. Denn sie ist letztendlich mitentscheidend für Trumps Agenda des radikalen Staatsabbaus, die von Interessengruppen massiv unterstützt wird, und damit auch für Trumps Wiederwahl. Schließlich würde eine demokratische Senatsmehrheit Trump nicht nur über die Gesetzgebung, sondern auch über die Judikative daran hindern, Amerika im Sinne staatskritischer Interessengruppen weit über seine vier- oder achtjährige Amtszeit Trumps hinaus radikal zu verändern, indem er weitere Richter auf Lebenszeit einsetzt.
Im Sinne der Waffen-Lobby, der Wall Street sowie der Öl- und Gasindustrie, deren Zuwendungen für seine mögliche Wiederwahl hilfreich sind, hat Trump bereits ganze Arbeit geleistet. Trump engagierte als Finanzminister Steven Mnuchin, der sein politisches Handwerk als Hedgefonds-Manager und politischer Fundraiser bei der Investmentbank Goldman Sachs lernte. Dieser baut die ohnehin behutsamen Regulierungen der Obama-Regierung im Finanzsektor über den Gesetzweg wieder ab.
Auch in der Energie- und Umweltpolitik verfolgt Trump systematisch eine Strategie von Deregulierung und Demontage: Das Energieministerium leitet mit Rick Perry ausgerechnet der Mann, der es als Kandidat im Präsidentschaftswahlkampf abschaffen wollte. Zuvor diente er als Gouverneur von Texas; es war die Erdölindustrie, die seine Wahl auf diesen Posten finanziert hatte. In der Umweltschutzbehörde gab zunächst Scott Pruitt den Ton an. Auch er ist ein ehemaliger Lobbyist, der in Zusammenarbeit mit Energieunternehmen die von ihm geleitete Behörde mehrfach verklagt hatte, um Umweltschutzbestimmungen über den Rechtsweg auszuhebeln. Sein Nachfolger ist sein bisheriger Vize Andrew Wheeler, ein ehemaliger Lobbyist für die Kohle- und Bergbau-Branche. Zuvor war er langjähriger Berater des republikanischen Senators James Inhofe und unterstützte dessen Gesetzesvorhaben, die den Klimawandel als Angstmache unseriöser Wissenschaftler brandmarkten. Auch er will Barack Obamas Umweltregulierungen mit allen Mitteln rückgängig machen.
Allen voran investieren Charles und David Koch, die milliardenschweren Erben eines Öl- und Chemiekonglomerats, seit Jahrzehnten enorme Summen, um den besteuernden und regulierenden Staat möglichst kleinzuhalten. Dazu leisten sie Wahlkampfspenden und finanzieren ein Netz von Dutzenden von Organisationen, Think Tanks und Wahlkampfkomitees, sogenannte Political Action Committees, PACs. Auch die von ihnen finanzierten Tea-Party-Aktivisten sind davon beseelt, den regulierenden Einfluss des Staates auf die Wirtschaft und Gesellschaft zu unterbinden.
Um die ihren Interessen entsprechenden libertären Ideen einer radikal-freien Marktwirtschaft in die Tat umzusetzen, mischt sich das Koch-Netzwerk auch immer wieder mit „siebenstelligen Beträgen“ in das politische Geschäft ein, um gefällige Richternominierungen zu unterstützen. Aktivisten von „Americans for Prosperity“ (AFP), eine der von den Koch-Brüdern initiierten und finanzierten Organisationen, rufen in Anzeigenkampagnen und bei Veranstaltungen die Wähler dazu auf, ihre Senatoren anzurufen, damit diese den gewünschten Kandidaten absegnen.[31]
Systematisch lanciert die Trump-Administration ihre Strategie des Staatsabbaus auch im Bereich der richterlichen Gewalt, nach demokratischen Grundsätzen eigentlich unabhängiger Wächter und Korrektiv der Exekutive. Peu à peu arbeitet das Weiße Haus an der Ausrichtung der Bundesgerichtsbarkeit von der untersten Ebene über die Berufungsgerichte bis hin zur höchsten Instanz, dem „Supreme Court“. Auch mit seinen Richterbenennungen setzt Trump um, was Bannon unter dem Schlagwort „Rückbau des Verwaltungsstaates“ angekündigt hatte.[32]
Dass Trump schnell und effektiv handeln kann, wenn es ihm wichtig ist, zeigt Neil Gorsuchs Nominierung an den „Supreme Court“ nur elf Tage nach Trumps Amtseinführung. Anders als sein Vorgänger Barack Obama, der sich über ein Jahr lang vergeblich abmühte und an einer eisernen Verweigerungshaltung der Republikaner scheiterte, den freien Richterstuhl im „Supreme Court“ zu besetzen, drückte Donald Trump seinen Kandidaten mit der sogenannten „Nuklearoption“ durch, sprich unter Umgehung der bis dato bei Abstimmungen geltenden Kontrollmechanismen im Parlament.
Der auf die Demontage des Staates ausgerichtete Präsident Trump sicherte sich so einen Mitstreiter an der Spitze der US-amerikanischen Gerichtsbarkeit: Mit Ausnahme seiner Haltung gegen Abtreibung – die Trumps christlich rechte Basis für eine mögliche Wiederwahl zufrieden stellen würde – gilt der ultra-konservative Gorsuch als Feind staatlicher Eingriffe in die private und wirtschaftliche Sphäre.
Mit der Benennung von Brett Kavanaugh im September 2018 will Trump nunmehr seinen zweiten regulierungsfeindlichen Mitstreiter im Obersten Gericht lancieren. Kavanaugh hat sich im Laufe seiner langjährigen juristischen Karriere mehrfach gegen staatliche Eingriffe in die wirtschaftliche Sphäre ausgesprochen.[33] Weitere regulierungsfeindliche Richter könnten folgen, es sei denn, Trump und die Republikaner verlieren bei den Kongresswahlen im November die Senatsmehrheit an die Demokraten.
2.3 Für Trump weniger problematisch: Verlust der Mehrheit im Abgeordnetenhaus
Weitaus weniger problematisch für Trump und seine Unterstützer wäre der alleinige Verlust der Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Trump hat ohnehin schon mithilfe staatsfeindlicher Republikaner das wichtigste Ziel, die Steuerreform, erreicht.
Dank der Umsetzung von Trumps Wirtschaftsplänen, die an die „Zauber-Ökonomie“ Ronald Reagans erinnern, werden – wie schon in den 1980er Jahren – die ohnehin schon exorbitanten Staatsschulden weiter ansteigen. Bereits jetzt laufen sie aus dem Ruder: Seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2007/08 haben sie sich auf derzeit 19 Billionen Dollar verdoppelt; darin sind die Schulden der Einzelstaaten und Kommunen nicht einmal eingerechnet.[34]
Schon bald könnte der amerikanische Staat also handlungsunfähig werden – zumal die demografische Entwicklung in absehbarer Zeit zusätzlich die Sozialkassen sprengen wird. In wenigen Jahren erreicht die Generation der „Baby-Boomer“ das Rentenalter und belastet zusätzlich die Rentenversicherung wie auch „Medicaid“ und „Medicare“, die Krankenfürsorge für sozial Schwächere bzw. für Ältere und Behinderte. Wie seine Vorgänger wird sich Trump davor hüten, die oft überlebenswichtigen Programme für ältere Menschen anzutasten; dazu ist diese besonders aktive Wählergruppe auch für ihn zu wichtig. Ohne Einschnitte in diesem Bereich aber wird sich die Verschuldung nach Berechnung des Congressional Budget Office in zehn Jahren auf 86 Prozent des BIP und bis 2046 auf 141 Prozent des BIP auftürmen – eine Größenordnung, die selbst die im Zweiten Weltkrieg erreichte Höchstmarke von 106 Prozent übertrifft. Schon jetzt warnt die Behörde, dass der steigende Schuldenberg „substanzielle Risiken“ für das Land berge. Es drohe ein Finanzkollaps, der die Handlungsfähigkeit des Staates lahmlegen könne.[35]
Leere Kassen bedeuten Leerlauf für künftige Regierungen: Auch mit seiner Schuldenpolitik trimmt Trump den amerikanischen Staat somit auf die reduzierte Rolle hin, die ihm Lobbyisten und ihre Auftraggeber aus der Wirtschaft zubilligen. Tea-Party-Aktivisten wollen den Staat so klein wie möglich machen, damit man ihn „wie ein Baby im Bade ertränken“ könne – so eine häufig zitierte Witzelei von Grover Norquist, Stratege der libertären Bewegung und Chef der Vereinigung „Americans for Tax Reform“. In seinem Büro im Herzen Washingtons treffen sich mittlerweile wöchentlich bis zu 150 Amtsträger aus Legislative und Exekutive sowie Vertreter von Interessengruppen und Basisorganisationen. Ihr Thema: immer wieder die Steuerpolitik. Und Norquist hat eine große Mehrheit der Republikaner in Abgeordnetenhaus und Senat bereits dazu gebracht, öffentlich zu schwören, dass sie künftig keiner Steuererhöhung mehr zustimmen werden.
Als durch die jüngsten Steuererleichterungen der Schuldenberg um weitere Billionen Dollar erhöht wurde, ignorierten die Republikaner denn auch die prekäre Haushaltslage. Sie wird jedoch immer dann problematisiert, wenn es darum geht, Staatsausgaben zu erhöhen. Um nach der Steuerreform sein zweites großes wirtschaftspolitisches Ziel zu erreichen, ein kreditfinanziertes Infrastrukturprogramm, kann Trump also nicht mit der Unterstützung staatskritischer Republikaner im Kongress rechnen.
Zweckdienlicher für Trumps Infrastrukturpläne wäre demnach eine demokratische Mehrheit im Abgeordnetenhaus: Wenn es um Ausgaben geht, die den Wählern ihrer Wahlkreise und Einzelstaaten zugutekommen, sind gewerkschaftsnahe Demokraten, sogenannte „Old Liberals“, durchaus bereit, mit dem Präsidenten zu stimmen und sich auch gegen ihre fiskalkonservativen Parteifreunde, die „Blue Dogs“, zu positionieren.
Doch für den möglichen Fall, dass sich auch fiskalkonservative, mitunter staatsfeindliche Abgeordnete und Senatoren der republikanischen Partei trotz der Anreize durch Steuererleichterungen nicht bewegen sollten, wartet die politische Peitsche auf sie. Wenn der Präsident im politischen Handel keine Unterstützung erreicht, wird er das „bully pulpit“ bemühen. Präsident Theodore Roosevelt (1901-1909) prägte dieses Sprachbild einer Kanzel, um die Redeplattform zu beschreiben, mit der die Präsidentschaft die öffentliche Meinung beeinflussen kann. Der Präsident kann seine exponierte Stellung als einziger landesweit gewählter Politiker dazu nutzen, um über die alten Massenmedien und die neuen sozialen Medien auch die Wählerbasis der Kongressmitglieder für seine Agenda zu mobilisieren, damit die Mehrheit der Abgeordneten und Senatoren seiner Politik folgen.
Dafür benötigt Trump wieder die „modernen“ Massenmedien: Dazu zählt insbesondere das ultra-rechtes Breitbart News Netzwerk, mit dem er bereits im Wahlkampf, im sogenannten „Bodenkrieg“, die Truppen in Bewegung setzte und in ehemalige Wählerhochburgen der Demokraten eindrang.
Es ist durchaus möglich, dass Trump einen „New Deal“ mit dem selbsternannten Sozialisten und Arbeiterführer Bernie Sanders bewerkstelligt. Die beiden Freihandelskritiker sich darin einig, dass es zu allererst darum geht, amerikanische Arbeiter wieder in Lohn und Brot zu bringen: „America first“ – koste es, was es wolle.
Angesichts der niedrigen Zinsen sei die Gelegenheit günstig, zum Wohle der „Arbeiterklasse“ das Land neu aufzubauen und neue Wählerkoalitionen zu schmieden, erklärte Bannon. Er prophezeite seinem Präsidenten ähnlich aufregende Zeiten wie in den 1930er Jahren. Ihm schwebte „wagemutiges, hartnäckiges Experimentieren“ vor, ähnlich dem „New Deal“, als unter Präsident Roosevelts Führung die Karten neu gemischt wurden. Dies sei etwas viel Größeres, als es die „Reagan Revolution“ war: eine Verbindung von Konservativen und Populisten in einer „wirtschaftsnationalen Bewegung“.[36]
3. Fazit und Ausblick
Trumps „wirtschaftsnationale Bewegung“ hätte umso mehr Aufschwung, sollte Amerika sich auch an der Heimatfront wieder für einen Krieg rüsten müssen. So leidvoll der bislang letzte größere Krieg, der Waffengang gegen den Irak, auch für die Menschen vor Ort und für US-amerikanische Soldaten und deren Angehörige war, so gewinnbringend bleibt er für einige Industriezweige, allen voran für den militär-industriellen Komplex.[37]
Für Trump böte ein Krieg gegen einen äußeren Feind eine Chance, sich als Obersten Befehlshaber bei den Wählerinnen und Wählern zu profilieren.
Selbst in „Friedenszeiten“ hat Trump eine gute Chance, wiedergewählt zu werden. Mit der finanziellen Unterstützung der Militär-, der Finanz- sowie der Öl- und Gasindustrie und dem Segen der christlich Rechten ist der amtierende Präsident gut gerüstet, bei den nächsten Präsidentschaftswahlen 2020 im Amt bestätigt zu werden.
Vielleicht hat Trump noch einen „New Deal“ in der Hinterhand: Er hätte sogar umso bessere Karten, wenn die Republikaner bei den anstehenden Zwischenwahlen ihre Mehrheit im Abgeordnetenhaus verlören. Er könnte dann einerseits sein kostspieliges und kreditfinanziertes Infrastrukturprogramm leichter im Schulterschluss mit den weniger fiskalkonservativen Demokraten bewerkstelligen und sie andererseits auch für Misserfolge in anderen Bereichen verantwortlich machen.
Erheblich schwieriger würde Trumps politische Zukunft hingegen, sollten die Demokraten auch die Mehrheit im Senat gewinnen. Dann würden intensivere Kontrollmechanismen greifen; es stünde sogar ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump im Raum. Zumal Trumps hartnäckiger Gegenspieler, Sonderermittler Mueller, hält bei seinen Ermittlungen gegen Trump und dessen „Vertrauten“ wohl noch einige Trümpfe in der Hand.
Es wäre jedoch eine weitere Ironie der US-amerikanischen Geschichte, wenn ausgerechnet jener Hoffnungsträger vieler westlich orientierten Beobachter zum „Treiber“ Dynamik würde, die Trump stärkt: Je mehr sich Sonderermittler Mueller mit Trumps ehemaligen Vertrauten in deren Strafverfahren mit sogenannten „Plea Deals“ verständigt und diese mit ihren Aussagen den Präsidenten und seine Entourage in die Enge treiben helfen, desto höher wird das Risiko für Trump, seines Amtes enthoben zu werden. Doch umso größer wäre dann die Gefahr, dass Trump entgegen der Mahnung seiner Berater einen Krieg vom Zaun bricht, der wiederum dazu führen könnte, dass sich seine patriotischen Landsleute stärker hinter ihrem Präsidenten und Oberbefehlshaber scharen.
Strategisch orientierte Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft sollten deshalb nicht nur auf das hierzulande erhoffte Szenario einer Blockade oder gar auf eine Amtsenthebung Trumps setzen, sondern sich darauf einstellen, dass der Präsident und Oberbefehlshaber auch gestärkt aus den Kongresswahlen am 6. November hervorgehen könnte. Eine Neuausrichtung der transatlantischen Beziehungen wäre dann umso dringlicher.
Dr. Josef Braml ist USA-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und Autor des Buches „Trumps Amerika – Auf Kosten der Freiheit“. Aktuelle Analysen veröffentlicht er auch über seinen Blog usaexperte.com.
Anmerkungen:
[1] Für eine umfangreichere Einführung des Autors siehe Josef Braml, Politisches System der USA, Bonn: Bundeszentale für Politische Bildung 2013.
[2] Emil Hübner und Heinrich Oberreuter, Parlament und Regierung. Ein Vergleich dreier Regierungssysteme, München 1977; Winfried Steffani, Parlamentarische und präsidentielle Demokratie. Strukturelle Aspekte westlicher Demokratien, Opladen 1979; ders., Regierungsmehrheit und Opposition, in: Winfried Steffani und Jens-Peter Gabriel (Hrsg.), Regierungsmehrheit und Opposition in den Staaten der EG, Opladen 1991, S. 11-35.
[3] „The confidence rule is the central element upon which the logic of the parliamentary system rests.“ R. Kent Weaver, Are Parliamentary Systems Better?, in: Brookings Review 3 (1985) 4, S. 16-25; hier: S. 17.
[4] Richard E. Neustadt beschreibt das US-amerikanische System treffend als „government of separated institutions sharing powers“. Charles O. Jones präzisierte Neustadts Idiom folgendermaßen: „separated institutions sharing and competing for powers“. Siehe Richard Neustadt, Presidential Power and the Modern Presidents. The Politics of Leadership from Roosevelt to Reagan, New York und Toronto 1990, S. 29; Charles O. Jones, The Presidency in a Separated System, 2. Aufl., Washington, D.C. 2005, S. 24.
[5] James L. Sundquist, Needed, A Political Theory for the New Era of Coalition Government in the United States, in: Political Science Quarterly, 103 (1988) 4, S. 613-635; auch Weaver und Rockman differenzieren zwischen diesen beiden „Regimetypen“: R. Kent Weaver und Bert A. Rockman, Assessing the Effects of Institutions, in: dies. (Hrsg.), Do Institutions Matter? Government Capabilities in the United States and Abroad, Washington, D.C. 1993, S. 1-41.
[6] Vgl. Patrick Horst, Haushaltspolitik und Regierungspraxis in den USA und der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt am Main 1995, S. 85-86. Kurt L. Shell beschreibt die „antagonistische Partnerschaft“ zwischen Kongress und Präsident treffend als den „Kern des amerikanischen politischen Systems, der es von parlamentarischen europäischen [Systemen] unterscheidet“. Ders., Kongreß und Präsident, in: Willi Paul Adams und Peter Lösche (Hrsg.), Länderbericht USA, Bonn 1998, S. 207.
[7] Vgl. Klaus von Beyme, Die politische Klasse im Parteienstaat, Frankfurt am Main 1993; Suzanne S. Schüttemeyer, Fraktionen im Deutschen Bundestag 1949-1997. Empirische Befunde und theoretische Folgerungen, Opladen 1998; ebd., Parliamentary Parties in the German Bundestag, Washington, D.C. 2001.
[8] „Nor should one expect political parties in a separated system to exercise power they do not or cannot possess“, so Charles O. Jones, The Presidency in a Separated System, a.a.O. (Anm. 4), S. 18.
[9] Philip Rucker und Robert Costa, Bannon Vows a Daily Fight for ‘Deconstruction of the Administrative State’, in: Washington Post, 23.2.2017, <https://www.washingtonpost.com/politics/top-wh-strategist-vows-a-daily-fight-for-deconstruction-of-the-administrative-state/2017/02/23/03f6b8da-f9ea-11e6-bf01-d47f8cf9b643_story.html?utm_term=.4c32d95b233d> (abgerufen am 17.9.2018).
[10] Lisa Rein und Juliet Eilperin, White House Installs Political Aides at Cabinet Agencies to Be Trump’s Eyes and Ears, in: Washington Post, 19.3.2017, <https://www.washingtonpost.com/powerpost/white-house-installs-political-aides-at-cabinet-agencies-to-be-trumps-eyes-and-ears/2017/03/19/68419f0e-08da-11e7-93dc-00f9bdd74ed1_story.html?hpid=hp_hp-top-table-main_minders-705pm:homepage/story&utm_term=.4d89b5fb4405> (abgerufen am 17.9.2018).
[11] Bob Woodward, Furcht: Trump im Weißen Haus, Rowohlt 2018.
[12] Anonymous, I Am Part of the Resistance Inside the Trump Administration, in: New York Times, 5.9.2018, <https://www.nytimes.com/2018/09/05/opinion/trump-white-house-anonymous-resistance.html> (abgerufen am 17.9.2018).
[13] Isobel Thompson, Trump’s Fear of a Deep State Coup Has Become Full-blown Hysteria, in: Vanity Fair, 23.5.2018, <https://www.vanityfair.com/news/2018/05/trump-deep-state-coup-hysteria> (abgerufen am 17.9.2018).
[14] Julie Pace, Trump Acknowledges for First Time He’s Under Investigation, in: Associated Press, 16.6.2017, <https://www.apnews.com/0172a576e8124251b5478818d1944632> (abgerufen am 17.9.2018).
[15] Isobel Thompson, Trump’s Fear, a.a.O. (Anm. 13).
[16] Zitiert nach Ross Baker, House and Senate, New York und London 1995, S. 91).
[17] Wenn die Waffen sprechen, schweigen die Gesetze. Im Krieg ist das Recht kraftlos. Cicero, Rede für Milo § 11 a.A.S.a.C 88, J 114 u. V 32. Übersetzung von Detlef Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, München: Beck, 1982, S. 197.
[18] William H. Rehnquist, All the Laws but One: Civil Liberties in Wartime, New York und Toronto: Alfred A. Knopf/Random House, 1998.
[19] Ausführlicher dazu Josef Braml, Freie Hand für Bush? Auswirkungen der Kongreßwahlen auf das innenpolitische Machtgefüge und die Außenpolitik der USA, SWP-Aktuell Nr. 55/02, Dezember 2002, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik.
[20] Amerikaner, die das Thema Wirtschaft ganz oben auf ihre Prioritätenliste platzierten, sprachen sich zu etwa gleichen Teilen für die beiden Parteien aus (49 Prozent für die Republikaner und 48 Prozent für die Demokraten; laut Gallup-Umfrage vom 31. Oktober bis 3. November 2002).
[21] Gemäß einer Gallup-Umfrage vom 8. bis 10. November 2002 waren knapp zwei Drittel (64 Prozent) der Befragten der Meinung, dass die Republikaner im Kampf gegen den Terrorismus die nötige Härte zeigen (nur 27 Prozent nahmen an, sie seien nicht hart genug). Im Vergleich dazu wurde den Demokraten entschieden weniger Härte zugetraut: Nur etwa ein Drittel (34 Prozent) der Befragten war kurz vor den Wahlen davon überzeugt, dass die Demokraten das Problem des Terrorismus entschlossen in Angriff nehmen würden, während 57 Prozent den Demokraten die nötige Härte absprachen.
[22] Gallup-Umfrage vom 31. Oktober bis 3. November 2002.
[23] Ausführlicher dazu Josef Braml, Machtpolitische Stellung des Präsidenten als Schutzpatron in Zeiten nationaler Unsicherheit, in: Peter Rudolf et al. (Hrsg.): Zwei Jahre Präsident Bush, SWP-Studie Nr. S 9, März 2003, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, S. 35-39.
[24] Trent Lott zitiert in: ebd.
[25] Ausführlicher: Josef Braml, USA und Nordkorea: Was sind die Motive von Donald Trump?, Tagesspiegel, 26.5.2018, <https://www.tagesspiegel.de/politik/usa-und-nordkorea-was-sind-die-motive-von-donald-trump/22606238.html> (abgerufen am 17.9.2018).
[26] John R. Bolton, To Stop Iran’s Bomb, Bomb Iran, in: New York Times, 26.3.2015, <https://www.nytimes.com/2015/03/26/opinion/to-stop-irans-bomb-bomb-iran.html> (abgerufen am 17.9.2018).
[27] Amber Phillips, Mueller’s indictment of 12 Russians lands at a really awkward moment for Trump, in: Washington Post, 13.7.2018, <https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2018/07/13/muellers-indictment-of-12-russians-lands-at-a-really-awkward-moment-for-trump/?utm_term=.4d32c4ad55dd&wpisrc=nl_politics-pm&wpmm=1> (abgerufen am 17.9.2018).
[28] Donald Trump zitiert in: Ashley Parker, Robert Costa und Felicia Sonmez, Trump says he accepts U.S. intelligence on Russian interference in 2016 election but denies collusion, in: Washington Post, 18.07.2018, <https://www.washingtonpost.com/politics/growing-number-in-gop-call-for-trump-to-fix-the-damage-from-helsinki-news-conference/2018/07/17/7ea15178-8902-11e8-8aea-86e88ae760d8_story.html?utm_term=.531b7cbb47db> (abgerufen am 17.9.2018).
[29] Oliver Georgi, Eine Amtsenthebung wird zum Krieg führen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ.net, 18.5.2017, <http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/donald-trump-eine-amtsenthebung-wird-zum-krieg-fuehren-15021952.html> (abgerufen am 17.9.2018).
[30] Griffin Connolly, Steve Bannon’s bleak message for GOP: blue wave=Trump’s impeachment, in: Roll Call, 20.8.2018, abrufbar unter: https://www.rollcall.com/news/politics/steve-bannon-warns-gop-trump-impeachment.
[31] Heike Buchter, Milliarden fürs Mitreden, in: ZEIT Online, <https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-07/supreme-court-koch-brueder-lobbyismus-freie-marktwirtschaft> (abgerufen am 17.9.2018).
[32] Philip Rucker und Robert Costa, Bannon vows a daily fight for ‘deconstruction of the administrative state’, in: Washington Post, 23.2.2017, <https://www.washingtonpost.com/politics/top-wh-strategist-vows-a-daily-fight-for-deconstruction-of-the-administrative-state/2017/02/23/03f6b8da-f9ea-11e6-bf01-d47f8cf9b643_story.html?utm_term=.4c32d95b233d> (abgerufen am 17.9.2018).
[33] Ausführlicher: Scott Shane, Steve Eder, Rebecca R. Ruiz, Adam Liptak, Charlie Savage und Ben Protess, Influential judge, loyal friend, conservative warrior — and D.C. insider, in: New York Times, 14.7.2018, <https://www.nytimes.com/2018/07/14/us/politics/judge-brett-kavanaugh.html> (abgerufen am 17.9.2018).
[34] Congressional Budget Office, The 2016 Long-Term Budget Outlook, Washington, D.C., 12.7.2016, S. 6.
[35] Ebd. S. 9.
[36] Michael Wolff, Ringside with Steve Bannon at Trump Tower as the President-Elect’s Strategist Plots ’An Entirely New Political Movement’, in: The Hollywood Reporter, 18.11.2016, <http://www.hollywoodreporter.com/news/steve-bannon-trump-tower-interview-trumps-strategist-plots-new-political-movement-948747?wpisrc=nl_daily202&wpmm=1> (abgerufen am 17.9.2018).
[37] Ausführlicher: Josef Braml, Militärisch-industrieller Komplex, in: Thomas Jäger (Hrsg.): Die Außenpolitik der USA. Eine Einführung, Wiesbaden: Springer VS, 2017, S. 85-102.
Kommentare lesen und schreiben, hier klicken